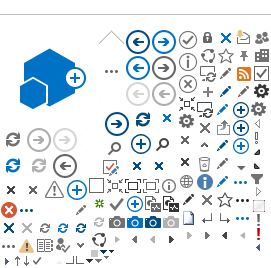Kann ich mich schon vor dem
Staatsexamen bewerben?
Ja,
mit konditionierter Zulassung (§ 5 Abs. 1 Ziff. 2), jedoch muss das
Staatsexamen vor Abschluss der Promotion bestanden sein (§ 12).
Wie lange bleibe ich in der
Doktorandenliste?
Bis
zu 6 Jahre mit Option auf Verlängerung um 3 weitere Jahre (§ 3 Abs. 4).
Muss ich die Dissertation
verteidigen?
Ja,
eine öffentliche Verteidigung ist verpflichtend (§ 13).
Wo reiche ich meine Unterlagen ein?
Alle Unterlagen müssen im DPVS hochgeladen werden (Reiter: Nachreichen von Abschlussunterlagen, Nachreichen von Unterlagen) und danach im Referat Forschung, Promotionsbüro der Medizinischen Fakultät.
Benötige ich eine Genehmigungen für
die Benutzung publizierter Abbildungen?
Ein
Bildzitat ist immer dann ausreichend, wenn die Abbildung den Zitatzweck erfüllt
- also die eigenen Gedanken oder Ausführungen belegt oder unterstützt. Dann
dürfen aber auch keinerlei Änderungen vorgenommen werden. Wenn es kein Zitat im
genannten Sinne ist, sollten die Rechte eingeholt werden - was für
Dissertationen in der Regel kostenfrei möglich ist. Alternativ kann ggf. eine
eigene Abbildung erstellt werden, unter Nennung der ursprünglichen Quelle. Dann
sollten aber deutliche Änderungen zum Original oder zur "Inspiration"
vorliegen.
Wie finde ich ein Thema und eine Betreuer:in für eine Promotion?
Bitte recherchieren Sie selbstständig im Internetauftritt der Einrichtungen der Medizinischen Fakultät. Einige aktuelle Promotionsangebote stehen unter Termine und Aktuelles.
Welcher Doktortitel kommt für mich in Frage?
Das ist abhängig von Ihrem Hochschulabschluss und ggf. vorherigen Graduierungen und sollte in enger Abstimmung mit Ihrem Betreuer/Betreuerin erfolgen.
Kann ich an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig promovieren ohne in Leipzig studiert zu haben?
Ja, ihr Hochschulabschluss muss den Zulassungsvoraussetzungen der Promotionsordnung entsprechen.
Was muss ich beachten, wenn ich meinen Studienabschluss im Ausland erworben habe?
Sie müssen bereits für den Antrag auf Annahme als Doktorand:in die gleichwertigkeit des ausländischen Hochschulabschlusses nachweisen. Hier gibt es unter Downloads und Dokumente eine Handreichung.