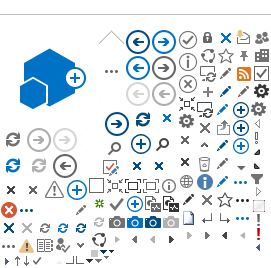Die beiden Vorstände des Universitätsklinikums, Prof. Christoph Josten und Dr. Robert Jacob, zu den Herausforderungen der Corona-Pandemie.
„Es war die dritte oder vierte Februarwoche. Die Kollegen kehrten entspannt aus dem Wintersport zurück. Da ahnten wir noch gar nichts", erinnert sich Prof. Christoph Josten. „Dann kamen die ersten Erkrankungen in Bayern
und es entwickelte sich so eine Ahnung: Da kommt was auf uns zu. Ich glaube, das haben wir beide gefühlt." Der Medizinische Vorstand des UKL schaut zum Kaufmännischen Vorstand. Dr. Robert Jacob nickt: „Ja, es begann schleichend. Das ungute Gefühl verstärkte sich von Woche zu Woche. Aber so richtig greifbar war die Situation erst einmal nicht. Im März dann, als die ersten Patienten kamen, wurden wir vor erste Entscheidungen gestellt. Und ab Mitte März ging es dann Schlag auf Schlag, recht parallel zur Eskalation im ganzen Land mit Ausgangsbeschränkungen und Lockdown."
was auf uns zu. Ich glaube, das haben wir beide gefühlt." Der Medizinische Vorstand des UKL schaut zum Kaufmännischen Vorstand. Dr. Robert Jacob nickt: „Ja, es begann schleichend. Das ungute Gefühl verstärkte sich von Woche zu Woche. Aber so richtig greifbar war die Situation erst einmal nicht. Im März dann, als die ersten Patienten kamen, wurden wir vor erste Entscheidungen gestellt. Und ab Mitte März ging es dann Schlag auf Schlag, recht parallel zur Eskalation im ganzen Land mit Ausgangsbeschränkungen und Lockdown."
Die beiden Vorstände blicken zurück auf den Beginn der Corona-Pandemie: Die ersten Nachrichten aus China, dann der erste Fall in Deutschland, der Ischgl-Hotspot. Prof. Josten und Dr. Jacob waren auch im Winterurlaub. Man muss auch manchmal Glück haben: In Ischgl waren sie nicht. So konnten sie ihre volle Kraft einsetzen beim Bewältigen all der Aufgaben, vor die sie von der Virus-Pandemie plötzlich gestellt wurden.
Eine davon war die Corona-Ambulanz. „Es kamen im März auf einmal Urlaubsrückkehrer, die getestet werden wollten. Was tun? Vielleicht schleppen die uns das Virus ins Klinikum? Also wurde innerhalb von zwei Tagen eine Corona-Ambulanz aufgebaut und die Wege dorthin wurden so geordnet, dass mögliche Träger des Virus nicht mit normalen Patienten zusammentreffen", erzählt Prof. Josten. „In der zweiten Märzwoche war das, und uns wurde bewusst: Hier geht etwas los, das wir alle noch nicht erlebt haben. Also hieß es einerseits, ruhig zu bleiben und andererseits schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dafür wiederum war uns die Kompetenz von Fachleuten wichtig. Deshalb implementierten wir eine Task Force, einen Krisenstab, bei uns im Haus und suchten zugleich Kontakt zur Politik und zu anderen Krankenhäusern." Das Corona-Thema nahm Geschwindigkeit auf. Das was erst ganz weit weg war, kam näher und machte Angst. Erst China, Österreich und Bayern, dann die furchtbaren Bilder aus Italien.
„Mein Arbeitsalltag wurde ein total anderer. Keine Gespräche, Verhandlungen oder Treffen mehr mit externen Partnern. Keine langfristig angelegten Themen mehr. Stattdessen Krisenmeetings, vor allem Videokonferenzen, in unterschiedlichen Konstellationen. Und es mussten nur noch Tagesentscheidungen gefällt werden", sagt Dr. Jacob. Der Medizinische Vorstand ergänzt: „Keiner wusste doch, wie groß die Welle wird. Wir mussten plötzlich die Anzahl der Intensivbetten verdoppeln, Beatmungsgeräte besorgen und vor allem Schutzkleidung. Es ging auch um die schnelle Erhöhung des Intensivpflege-Personals, wir akquirierten Studenten." Stationen wurden geschlossen, Patienten verlegt, Operationen verschoben. Und alles im Galopp. „Das war eine unerhörte Entscheidungsgeschwindigkeit, die wir an den Tag legen mussten. Da mag nicht alles völlig logisch gewesen sein oder manches wurde verzögert oder nicht breit genug kommuniziert", gibt Dr. Jacob zu. „Aber im Prinzip lagen wir richtig."
Die Politik fragte die Vorstände um Rat, bezog sie direkt in die Vorbereitung von Entscheidungen ein. „Das hat dazu geführt, dass in diesen stürmischen Corona-Wochen ein Krankenhaus-Cluster entstand", berichtet Prof. Josten. „Auch verschiedene Probleme zwischen den Krankenhäusern waren mit einem Mal nicht mehr existent. Die Krankenhäuser sind sich nähergekommen, haben gelernt, große Herausforderungen gemeinsam zu lösen und es ist viel Vertrauen zur Politik entstanden – das ist eine nachhaltige Veränderung. Das sollte und wird Bestand haben."
Der Kaufmann verdeutlicht dieses neue Miteinander von Politik und Medizin: Zuvor wurde in den Krankenhäusern von der Politik, aber auch innerhalb des Klinikums, jeder Euro hinterfragt. Ist diese Ausgabe wirklich nötig? Diese Frage wurde durch Corona obsolet. Im Mittelpunkt stand nunmehr allein die Leistungsfähigkeit der Medizin. Welcher Aufwand dazu nötig war und ist, spielte erst einmal keine Rolle. Weil ein Grundvertrauen vorhanden war, das in der Krise weiterwuchs.
Bleiben werden hoffentlich auch andere Kontakte, die in der Pandemie aufgebaut wurden. Beispielsweise zu den Werkstätten der Oper Leipzig. „Als wir am 13. März unsere Corona-Ambulanz öffneten, merkten wir sehr schnell, dass wir den Bedarf an Mund-Nasen-Schutz bei weitem nicht decken können", erzählt Prof. Josten. Über den Krisenstab der Stadt Leipzig gab es einen Hinweis auf diese Werkstätten, denen in dieser Zeit ohnehin die Arbeit fehlte. Also nähten die Oper-Mitarbeiter mehrere Hundert Alltagsmasken für das Klinikum.
„Inzwischen kommen wir von den schnellen Entscheidungen wieder weg, und das ist auch gut so", betont Prof. Josten. „Denn wir müssen wieder eine langfristige Perspektive im Blick haben, Ruhe in die Abläufe bringen. Etwas, was bleiben wird, sind aber die persönlichen Eindrücke von diesen harten Krisenzeiten: Erstens waren unsere Mitarbeiter äußerst engagiert. Der Krankenstand war nicht höher als sonst, was aussagt, dass sich keine nennenswerte Zahl aus der Verantwortung stahl. Zweitens sahen wir sehr schnell, welche Mitarbeiter Krisensituationen sehr gut meisterten, Lösungen vorbereiteten, Ideen hatten und auch wussten, wie die umzusetzen sind…"
„…und drittens zeigte sich, dass die berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit sehr gut funktionierte", so Dr. Jacob. „Pflege, Verwaltung und Ärzte wirkten auf Augenhöhe erfolgreich zusammen. Das gilt es beizubehalten." Aus Sicht der Vorstände ist es insgesamt gut gelungen, den Mitarbeitern einerseits Sicherheit zu geben und andererseits sie mit einzubeziehen. Eine Telefon-Hotline und eine E-Mail-Adresse wurden eingerichtet für Fragen, Hinweise und Kritik. Hier gab es deutlich mehr positive als negative Reaktionen der Mitarbeiter.
Bleiben werden von der ersten Corona-Welle die Erfahrungen der Macher. Die Strukturen, die das Klinikum durch die Pandemie steuern halfen, haben sich bewährt und sind jederzeit wieder aufstellbar. Es gibt einen bewährten „Baukasten für die Krise", wie Dr. Jacob es nennt. Zudem wird bei der Bevorratung nicht mehr „auf knappe Kante genäht", so Prof. Josten. „Wir hatten vorher eine Lagerhaltung, die uns Verbrauchsmaterialen für eine bis zwei Wochen sicherte. Inzwischen haben wir die Menge erhöht, so dass wir drei bis sechs Wochen mit unseren Beständen hinkommen."
Mittlerweile trifft sich der Krisenstab nicht mehr täglich, sondern wöchentlich. In den letzten Wochen ging es um Fragen, wie das Klinikum am besten wieder in den Normalmodus übergehen könne, wie lange die Corona-Ambulanz noch nötig sei oder wie man mit den Sommerurlaub-Rückkehrern umgehe. „Auch das waren wieder Aufgaben, die noch niemand vor uns umgesetzt hat", sagt Prof. Josten. „Es gab keine Blaupause, wir mussten unseren Weg selbst finden."
Wie damals, als die Frage im Raum stand, ob italienische Corona-Patienten nach Leipzig geholt werden. Es war eine schwere Entscheidung. Denn es stand das Interesse zweier sehr kranker Patienten gegen den Schutz vieler anderer Patienten und Mitarbeiter. Und das angesichts aller möglicher Knappheiten im Klinikum und der Gewissheit, dass dann Intensivbetten mehrere Wochen lang belegt sind. „Heute ist völlig klar, dass es eine richtige Entscheidung war", betont der Medizinische Vorstand. „Wir waren übrigens das erste deutsche Krankenhaus, das ausländische Patienten aufnahm."
Vorreiter war das Klinikum auch bei Besucherregelungen, die von anderen Leipziger Krankenhäusern übernommen wurden. Auch der dann wieder zurückgenommene Stopp für werdende Väter, die bei der Geburt dabei sein wollten. „Heute würden wir diesen Stopp vielleicht nicht noch einmal verhängen", sagt Prof. Josten. „Aber noch einmal: Wer wusste damals, was richtig und angemessen war? Unsere allererste Aufgabe ist es doch, unsere Mitarbeiter vor Risiken zu schützen. Dafür hatten wir eine Philosophie: Das Klinikum ist eine Burg, die sich der Corona-Welle entgegenstellt. Und diese Burg müssen wir sichern."
Dem stimmt Dr. Jacob zu: „Wenn wir damals gewusst hätten, was wir jetzt wissen, hätten wir manches anders gemacht. Das ist nun mal im Leben so. Wichtig ist, den Mut zu haben, Entscheidungen auch zu revidieren und daraus für das nächste Mal zu lernen. Was wir unseres Erachtens hätten anders machen können, sowohl am UKL als auch in Deutschland insgesamt, ist das großflächige präventive Absagen von nicht notwendigen Operationen. Wir hatten die Überzeugung, dass das eine zu radikale Vorsichtsmaßnahme war. Aber wir haben es dann doch umgesetzt – aus Disziplin, immerhin hatte der Bundesgesundheitsminister darum gebeten. Und weil eben doch keiner genau wissen konnte, wie schlimm sich die Situation kurzfristig entwickelt."
Prof. Josten ergänzt: „Wenn der Bedarf wegen der Pandemie-Situation wirklich entsteht, können wir innerhalb weniger Tage durch Absage von Eingriffen und Entlassungen von Patienten erhebliche freie Bettenkapazitäten schaffen. Heute würden wir zudem mit unseren Erfahrungen sagen: Es ist möglich, beide Patientengruppen – die Corona-Infizierten und die normalen Patienten – zugleich zu behandeln, indem deren Wege strikt voneinander abgegrenzt werden."