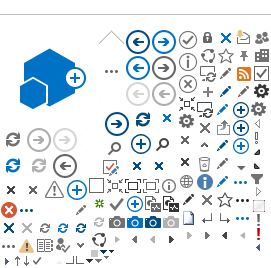Der Stellenwert einer medizinischen Dissertation ist hoch einzuschätzen. Unsere Klinik bietet für Promovenden hervorragende Möglichkeiten, klinische und experimentelle Forschungsarbeit zu leisten und diese mit einer Promotion abzuschließen.
Wir würden uns freuen, falls Sie Interesse haben, sich in einem Forschungsprojekt der Klinik für Viszeral-, Transplantations-, Thorax- und Gefäßchirurgie einzubringen und eine medizinische Dissertation zu verfassen. Bitte wenden Sie sich mit kurzer Darlegung Ihrer Vorstellungen nach Möglichkeit per E-Mail an das Sekretariat.
Prof. Dr. med. Daniel Seehofer
Klinik und Poliklinik für Viszeral-, Transplantations-, Thorax- und Gefäßchirurgie
Liebigstraße 20
D - 04103 Leipzig
E-Mail: chi2@medizin.uni-leipzig.de
______________________________________________________________________
*** Aktuell ***
*** Ausschreibung Dissertationsstelle für Medizinstudenten/innen ***
Klinik und Poliklinik für Viszeral-, Transplantations-, Thorax- und Gefäßchirurgie
Titel: Nrf2: Ein potenzielles Target für die Therapie des ösophagealen AdenokarzinomsInhalt/Beschreibung: In den letzten Jahrzehnten war die Inzidenz des ösophagealen Adenokarzinoms (EAC) in den westlichen Industrienationen von einem starken Anstieg geprägt. Das Ansprechen des EACs auf Chemotherapeutika ist relativ niedrig und die 5-Jahresüberlebsrate liegt bei 50 Prozent. Daher ist es notwendig, neue Therapieoptionen und -strategien zu entwickeln. Der Transkriptionsfaktor Nrf2 reguliert die Expression von Proteinen, die die Zelle vor allem vor oxidativem Stress schützt. Wir wollen untersuchen, welchen Einfluss die Nrf2-Aktivität auf die Chemosensitivität von ösophagealen Adenokarzinomzelllinien hat und ob eine Deaktivierung zu einer erhöhten Chemosensitivität in den Zellen führt.
Aufgabenstellung:
- Kultivierung der ösophagealen Zelllinien
- Durchführung von Transfektionsexperimenten und Behandlung der Zellen mit Chemotherapeutika
- Auswertung der Versuche mit molekularbiologischen und biochemischen Methoden (Expressionsanalysen, Proteinanalysen, FACS, ELISA etc.)
Nach einer initialen und intensiven methodischen Einarbeitung folgt eine selbstständige Arbeit innerhalb der gegebenen Fragestellung. In der Arbeitsgruppe findet ein wöchentliches Laborseminar statt, in dem die Ergebnisse besprochen und diskutiert werden.
Zeitraum: ca. 8 - 12 Monate, ab sofort
Interessenten/innen melden sich bitte bei:
Dr. René Thieme
Klinik und Poliklinik für Viszeral-, Transplantations-, Thorax- und Gefäßchirurgie
Zentrales Forschungsgebäude, Liebigstraße 19
Telefon: 0341 - 97 20809
E-Mail: rene.thieme@medizin.uni-leipzig.de