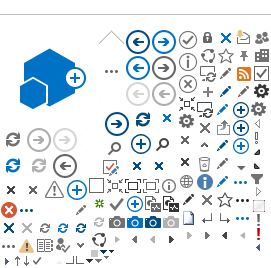19.11.20: Erschwerte Trauerbewältigung in Corona-Zeiten
Der November gilt als Trauermonat. Anlässlich des Totensonntags am 22. November gibt Prof. Dr. Anette Kersting, Professorin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig, Tipps zum Umgang mit den Themen Trauer und Abschiednehmen in Zeiten der Corona-Pandemie.
Weiter zur Pressemitteilung