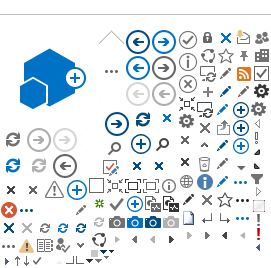wir freuen uns über Ihre Anfrage zu Promotionen in unserer Klinik. Bitte fügen Sie Ihrer Anfrage einen aktuellen Lebenslauf sowie Themenvorschläge hinzu: onkologie@medizin.uni-leipzig.de
Claudine sind Hauptbestandteile der sogenannten Tight Junctions in Epithelzellen, welche als ein- oder mehrlagige Zellschichten alle inneren und äußeren Körperoberflächen bedecken.
Claudine sind damit an der Signaltransduktion beteiligt und bei der Tumorentstehung in Prozesse wie Entzündung, Proliferation, Wachstum, Überleben, Metastasierung oder Therapieresistenz involviert.
Überexpression von Claudin 18.2 konnte in verschiedenen Tumoren nachgewiesen werden. Beim fortgeschrittenem Magenkarzinom werden derzeit verschiedene Therapeutika in klinischen Studien untersucht, die Claudin 18.2 als Targetmolekül für eine CAR-T-Zell- oder Antikörper basierte Therapie nutzen. Um besser einschätzen zu können, wie viele Patienten zukünftig von diesen Therapien profitieren könnten, möchte ich im Rahmen meiner Promotion die Häufigkeit einer Claudin 18.2 Überexpression bei Patienten mit fortgeschrittenem Magenkarzinom untersuchen.
Arbeitsthema: Einfluss bindender und neutralisierender Antikörper gegen Adeno-assoziierte-Viren auf die Transduktion von humanen Immunzellen mit Adeno-assoziierten Virus (AAV) Vektoren
Antonia Hollerbach gewinnt ein Promotionsstipendium der Medizinischen Fakultät
"Im Rahmen der von der Medizinischen Fakultät ausgeschriebenen Promotionsförderung für experimentelle Promotionsarbeiten habe ich mich für das Sommersemester 2022 beworben. Die Bewerbung erfordert einen 5-6-seitigen Antrag, in dem der wissenschaftliche Hintergrund und das Projekt selbst beschrieben werden. Außerdem wird vorausgesetzt, dass man sich in die Thematik und das Projekt bereits eingearbeitet hat. Neben der schriftlichen Bewerbung findet ein Kolloquium statt, bei dem die Möglichkeit besteht, das Vorhaben in einem kurzen Vortrag darzustellen. Alles in allem war der Prozess selbst für mich sehr hilfreich, um mich mit der Fragestellung auseinanderzusetzten und lehrreich mit Blick auf die Antragstellung und die Darstellung im Vortrag. Und so freue ich mich umso mehr, dass die Kommission mein Projekt zur Förderung im Rahmen eines Promotionsstipendiums angenommen hat und ich damit nun sechs Monate lang Stipendiatin der Medizinischen Fakultät sein darf!" Adeno-assoziierten-Virus (AAV) Vektoren werden schon heute zur Gentherapie bei bestimmten monogenetischen Erkrankungen eingesetzt. Für die Entwicklung neuer Therapieansätze zur Immuntherapie von Tumorerkrankungen stellt der Gentransfer in Dendritische Zellen (DC) eine wichtige Technologie dar. Bei bestimmten Virusinfektionen, wie z.B. bei Infektionen durch das Dengue Virus, wurde in Anwesenheit von Antikörpern, die im Rahmen einer vorangegangenen Infektion erworben wurden, eine Verstärkung der Aufnahme und Replikation der Viren in DC beschrieben und der Begriff des „Antibody Dependant Enhancement (ADE)" geprägt. Für AAV Vektoren konnte bereits gezeigt werden, dass präformierte Anti-AAV-Antikörper den AAV-vermittelten Gentransfer erhöhen können. Daten zum Einfluss auf die Transduktionseffizienz in humanen DCs fehlen jedoch bislang. Vor diesem Hintergrund möchte ich mit meiner Arbeit erstmals systematische Untersuchungen zum Einfluss von verschiedenen Antikörper-Subgruppen auf die Transduktion von humanen DC und die ausgelösten intrazellulären Mechanismen vornehmen.
Nora Hegewald
Arbeitsthema: Erfassung von Vorsorgedokumentation und Versorgungswünschen für ambulante Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen, soliden Tumoren unter palliativ intendierter Therapie – WAVP-Studie
Vorsorgedokumente, wie Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten, spielen in der Behandlungsführung von Patienten und Patientinnen mit inkurablen Krebserkrankungen eine wichtige Rolle, um Patientenwünsche zu respektieren. Allerdings herrscht aktuell kein Konsens, wenn es um die Frage geht ob, wann, durch wen und in welchem Ausmaß über Therapiebegrenzungen am Lebensende mit Patientinnen und Patienten gesprochen werden sollte.
Im Rahmen der WAVP-Studie wird der Zeitpunkt der Therapieplanung bzw. der Therapiebegrenzungen bereits in den ambulanten Sektor vorverlagert und dadurch die Möglichkeit einer frühzeitigen Versorgungsplanung gewährleistet.
Ziele der Studie sind die Erfassung von Versorgungswünschen im longitudinalen Verlauf sowie die Erfassung der Prävalenz von Vorsorgedokumenten und des Bedarfs an qualifizierter Beratung bezüglich solcher Dokumente.
Tim Kahl
Arbeitsthema: Analysen zur Onkogen-Expression und zu therapeutischen Interventionen in gastrointestinalen Patienten-Xenotransplantaten |  |
in Kooperation mit Prof. Aigner – Selbständige Abteilung für Klinische Pharmakologie Email: tim.kahl@medizin.uni-leipzig.de | Eines der Hauptprobleme aktueller und zukünftiger individualisierter Behandlungsstrategien in der Onkologie besteht darin, Modelle zu entwickeln, anhand derer sich die Wirksamkeit zielgerichteter Kombinationstherapien besser vorhersagen lässt. Patienten-Xenotransplantate (patient-derived xenografts, PDX) stellen ein neues und perspektivisch sehr aussagekräftiges Modellsystem dar, welches die komplexen tumorbiologischen Prozesse und die Heterogenität in einem individuellen Tumor widerspiegelt und an dem sich die Effekte diverser Therapiestrategien in parallelen Ansätzen vergleichend studieren lassen. Ziel meines Vorhabens ist es, ein standardisiertes Protokoll zur Generierung von PDX-Modellen für gastrointestinale Tumore zu entwickeln und zu validieren sowie therapeutische "proof-of-concept"-Studien durchzuführen und hierbei aus Genexpressions-Analysen abgeleitete, molekular definierte Behandlungsansätze zu evaluieren. |
Laura Hennig Arbeitsthema: Etablierung von Slice-Kulturen aus endoskopischen Material von Ösophagus- und Magenkarzinomen
In meinem Projekt möchte ich die Herstellung von Slice-Kulturen aus endoskopischen Biopsien von Magenkarzinomen weiter verfolgen und Möglichkeiten finden, diese über einen gewissen Zeitraum vital zu erhalten. An diesen Kulturen möchte ich die Effekte von Chemotherapeutika auf das Wachstums- und Sterbeverhalten der Tumorzellen anhand verschiedener biochemischer Marker studieren. Das Ziel ist es, in Zukunft ein Verfahren zu etablieren, mit Hilfe dessen das individuelle Ansprechen auf die Chemotherapie bereits vor Beginn derselben abgeschätzt werden kann. Zusätzlich können die Kulturen als Modelle dienen, um die Mechanismen der Entwicklung von Resistenzen gegenüber eingesetzten Substanzen genauer zu verstehen. Die notwendigen Experimente werde ich im Institut für Anatomie unter Leitung von Herrn Professor Ingo Bechmann durchführen.
Maria Tienken Arbeitsthema: Erfassung von Belastungen und Behandlungsbedarf von Patienten im Verlauf inkurabler Krebserkrankungen
Frau Tienken erhielt ein Promotionsstipendium, welches durch die Medizinische Fakultät gefördert wird. Die Diagnose einer inkurablen Krebserkrankung verändert das Leben eines Menschen nachhaltig. Im Angesicht einer palliativen Situation sehen sich PatientInnen und ihre Angehörigen mit neuen Sorgen, Ängsten und Belastungen konfrontiert. Im Rahmen dieser Studie der Arbeitsgemeinschaft für Palliativmedizin der Deutschen Krebsgesellschaft versuchen wir eben diese Belastungen und Symptome zu erfassen. Weiterhin sollen Rückschlüsse auf die Bedürfnisse und Präferenzen der PatientInnen in der weiteren Behandlung gezogen werden. In meinem Projekt führe ich mit inkurabel erkrankten PatientInnen des Universitären Krebszentrum Leipzig (UCCL) ein strukturiertes Interview zu eben diesen Themen zunächst zum Zeitpunkt der Diagnosestellung der inkurablen Krebserkrankung und anschließend im Erkrankungsverlauf. Ziel ist es, anhand der erfassten Daten die palliative Betreuung der Patienten durch genauere Kenntnisse möglicher Versorgungsdefizite und Risikofakten für Behandlungsbelastungen zu verbessern. |
| |
Abgeschlossene Promotionen:
Dr. med. Marlon Hußtegge
Arbeitsthema: "Charakterisierung des Erhalts und der Funktionalität von T-Zellen in organotypischen Tumorschnittkulturen aus Magenkarzinomen und Tumoren des ösophagogastralen Übergangs ex vivo"
Erfolgreich im Mai 2025 promoviert mit magna cum laude.
 | Email: marlon.husstegge@medizin.uni-leipzig.de Arzt in Weiterbildung |
| Zunehmend werden zielgerichtete Therapien und immunmodulatorische Medikamente bei verschiedenen gastrointestinalen Karzinomen klinisch eingesetzt. Diese richten sich sowohl gegen spezifische Zielstrukturen der Tumorzellen als auch gegen Komponenten des Tumorstromas. Die Interaktion zwischen Stromazellen und Tumorzellen spielt eine maßgebliche Rolle für Tumorprogression, Metastasierung und Immunsuppression. Dem Immunkompartiment – insbesondere den T-Zellen – kommt hierbei eine zentrale Bedeutung zu, da sie wesentlich zur Regulation der antitumoralen Immunantwort beitragen. Die meisten präklinischen Modelle (Zelllinien, murine Modelle) können den Tumor in seiner Komplexität mit dem umgebenden Tumormikromilieu nur unzureichend darstellen. Humane Tumorschnittkulturen (TSK) stellen eine vielversprechende Methode dar, Tumoren einschließlich ihres Stromas und Immunkompartiments über mehrere Tage in einer dreidimensionalen Struktur ex vivo zu kultivieren.
In humanen Tumorschnittkulturen möchte ich die Interaktion des Immuncheckpoint-Inhibitors Nivolumab mit den Tumorzellen sowie die tumorinfiltrierenden T-Zellen des Tumormikromilieus in ösophagogastralen Karzinomen untersuchen. Hierzu werden zunächst tumorinfiltrierende T-Zellen in TSK charakterisiert und hinsichtlich ihrer Funktionalität über den Kultivierungszeitraum untersucht. Anschließend erfolgt eine immunhistochemische Aufarbeitung sowie die Durchführung von mRNA-Analysen zur Untersuchung einer möglichen immunvermittelten Tumorreaktion nach Hinzugabe von Nivolumab. Ziel ist es, zu evaluieren, ob TSK aus gastrointestinalen Karzinomen als präklinisches Modell für immuntherapeutische Fragestellungen geeignet sind und damit zukünftig die Translation präklinischer Daten in frühe klinische Studien unterstützen können. |
Dr. med. Vivien Topf
Arbeitsthema: "Individuelle Vorhersage der Hämatotoxizität perioperativer Chemotherapie
Anwendung dynamischer biomathematischer Modelle bei Patienten mit gastrointestinalen Tumorerkrankungen"
Erfolgreich im April 2024 promoviert mit magna cum laude.
 | Ärztin in Weiterbildung E-Mail: vivien.topf@medizin.uni-leipzig.de |
| Klinisch sind Chemotherapie-bedingte Toxizitäten bisher nur schwer vorhersehbar, vor allem jene, die das blutbildende System betreffen. Es ist weitgehend unklar, welche Faktoren dafür verantwortlich sind, dass ein und die gleiche Therapie von verschiedenen Patienten unterschiedlich gut vertragen wird. Das Ziel dieser Untersuchung ist, die individuelle Vorhersagbarkeit dieser Toxizitäten zu untersuchen, um in der Folge eine speziell auf den einzelnen Patienten bezogene Risikovorhersage treffen zu können und die Verordnung eines personalisierten Therapieplans zu ermöglichen. |
Dr. med. Katharina Kolbe
Arbeitsthema: „Untersuchung der HER2-Heterogenität beim fortgeschrittenen Magenkarzinom innerhalb der VARIANZ-Studie"
Erfolgreich im Februar 2024 promoviert mit magna cum laude.
Die VARIANZ-Studie ist eine große nicht-interventionelle klinische Studie an Patienten mit fortgeschrittenen Magen- und Speiseröhrenkarzinom. Ziel dieser Studie ist ein besseres Verständnis über die Resistenzmechanismen gegen Chemotherapie und biologisch zielgerichtete Medikamente (z.B. Trastuzumab) zu erlangen. Dies bildet die Grundlage für die Entwicklung besser und länger wirksamer Medikamente. Im Rahmen der Studie wurde Tumormaterial der Patienten in lokalen Pathologien und erneut in der Leipziger Studienpathologie auf die Überexpression des Wachstumsfaktorrezeptoren HER2 getestet. Sind die Tumorzellen HER2-positiv, sind sie mit hoher Wahrscheinlichkeit gegenüber Trastuzumab sensibel. Die HER2-Testergebnisse der lokalen Pathologien weichen dabei bei fast einem Viertel der Patienten von den Testungen der Studienpathologie ab. Da die Ergebnisse der HER2-Testung von großer therapeutischer Relevanz für die Patienten sind, versuche ich in meiner Doktorarbeit den Ursachen der Abweichungen auf den Grund zu gehen.
Dr. med. Alina Krause
Arbeitsthema: Leitlinienadhärenz onkologischer Therapieentscheidungen am Universitären Krebszentrum Leipzig und Abweichungen in ihrer Umsetzung
Erfolgreich im September 2023 promoviert mit magna cum laude.
 | Ärztin in Weiterbildung E-Mail: Alina.Krause@medizin.uni-leipzig.de |
| Ziel moderner Krebsmedizin ist es, Patient:nnen mit Tumorerkrankungen durch Einhaltung evidenzbasierter Leitlinien Zugang zu bestmöglicher medizinischer Versorgung zu gewährleisten. Für Mammakarzinom-Patient:innen konnte bspw. bereits gezeigt werden, dass sich deren Rezidiv-freies Überleben und Gesamtüberleben durch leitlinienkonforme Therapie signifikant verbessert. Doch wie häufig Patient:innen mit Tumorerkrankungen in Deutschland tatsächlich Leitlinien-adhärent therapiert werden, ist bisher noch unklar. Unser Projekt wird die Leitlinienadhärenz von Tumorkonferenzempfehlungen am Universitären Krebszentrum Leipzig und die Gründe im Falle eines Abweichens von Leitlinien untersuchen. Weiterhin prüfen wir die Umsetzung dieser Tumorkonferenzempfehlungen und ermitteln Ursachen möglicher Abweichungen im Therapieverlauf. So wollen wir die Stärken und Schwächen der onkologischen Versorgung vor Ort sowie der zur Anwendung kommenden Leitlinien identifizieren und damit auch einen Beitrag zur bestmöglichen Behandlung zukünftiger Patient:innen leisten. |
Dr.med. Justus Körfer
Arbeitsthema: Etablierung von Slice-Kulturen bei Ösophagus- und Magenkarzinomen
Erfolgreich im März 2017 promoviert mit magna cum laude.
 |
Facharzt
|
In meinem Projekt möchte ich die Methode der Slice-Kulturen als in vitro Modell zur Therapievorhersage bei Magen- und Ösophaguskarzinomen etablieren. Dazu werde ich Tumorgewebeproben aus der Chirurgie (PD Dr. Bartels, Prof. Dr. Eichfeld) erhalten, im Institut für Pathologie (Prof. Wittekind) die geeigneten Tumorbereiche dissezieren und im Institut für Anatomie (Prof. Bechmann) meine Experimente durchführen. Nach der Kultivierung der Tumorslices sind die Tumorzellen noch für einen längeren Zeitraum vital, so dass verschiedene Chemotherapeutika getestet und Resistenzmechanismen untersucht werden können. Im weiteren Verlaufe werde ich versuchen, aus noch kleineren, endoskopischen Biopsien Slicekulturen zu erstellen.
Dr. med. Rasmus Sönnichsen
Arbeitsthema: Klinische Anwendbarkeit von Dünnschnitt-Gewebekulturen bei Speiseröhren- und Magenkarzinomen
Erfolgreich im Juni 2019 promoviert mit summa cum laude.
 | |
In meinem Projekt möchte ich die Methode der Slice-Kulturen aus Magen- und Ösophaguskarzinomen im Hinblick auf die Anwendbarkeit in der Klinik weiterentwickeln. Hierzu will ich das System und seine Auswertung objektiver gestalten und vereinfachen. Außerdem soll die Herstellung von Slice Kulturen aus Biopsien realisiert werden. An den kultivierten Tumorslices können dann z.B. verschiedene Chemotherapeutika getestet und das Tumorzellverhalten untersucht werden.
Meine Experimente werde ich im Institut für Anatomie (Prof. Bechmann) durchführen.
Ziel ist es, in der Zukunft an solchen Slice-Kulturen das Ansprechen eines Patienten auf Medikamente besser einschätzen zu können und die Therapie entsprechend anzupassen. So kann Patienten eventuell zukünftig eine personalisierte Therapieform angeboten werden.
Herr Sönnichsen erhielt ein Promotionsstipendium, gefördert durch die Medizinische Fakultät Leipzig.
Dr. med. Robert Jenke
Arbeitsthema: Signaltransduktion und biologische Bedeutung von epidermalen Wachstumsfaktorrezeptoren in Magenkarzinomzellen
Erfolgreich im Juni 2020 promoviert mit magna cum laude.
Herr Jenke erhielt ein Promotionsstipendium, gefördert durch die Medizinische Fakultät Leipzig.
In meinem Projekt soll die tumorbiologische Funktion der epidermalen Wachstumsfaktorrezeptoren HER1, HER2 und HER3 in Magenkarzinomzellen beleuchtet werden. Es soll dabei das Expressionsmuster der Rezeptoren und möglicher distaler Signalmoleküle in einer Reihe von Modellzelllinien und ggf. in primären Tumorproben untersucht werden. Weiterhin steht die Charakterisierung HER-gesteuerter Signalkaskaden im Fokus. Absicht dieser Untersuchungen ist es, neue Angriffspunkte zu finden, die gezielt das Tumorwachstum einschränken können. Zum Einsatz kommen dabei quantitative RT-PCR Analysen und proteinbiochemische Verfahren wie Western Blot, sowie zellbiologische Nachweise zur Erfassung der zellulären Proliferation und Apoptoserate.
Dr. med. Sebastian Prill
Arbeitsthema:
Immunkompetenz und -regulation in Slice-Kulturen des Magenkarzinoms
Erfolgreich im Juli 2020 promoviert mit magna cum laude.
In meinem Projekt soll die Makrophagenpopulation in Tumorschnitten des Magenkarzinoms untersucht werden. Makrophagen gehören zu den Zellen der angeborenen Immunabwehr, regulieren aber auch das extrazelluläre Milieu und können somit Anti- aber auch Pro- kanzerogen wirken. Meine Experimente werde ich am Institut für Anatomie durchführen.
Dr. med. David Kotzerke
Arbeitsthema: Prädikative Wertigkeit dreier onkogeriatrischer Screenings: G8, optimierter G8 sowei CARG (Hurria) Score bezüglich der Vorhersage schwerer Chemotherapie assoziierter Toxizität bei älteren Krebspatienten
Erfolgreich im Januar 2021 promoviert mit magna cum laude.
Herr Kotzerke erhielt ein Promotionsstipendium, gefördert durch die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie (DGHO).
Gegenstand meiner klinischen Studie ist die Erhebung zweier Screening-Fragebögen bei älteren Patienten über 65 Jahre um chemottherapieassoziierte Nebenwirkungen (Toxizitäten) vorherzusagen.
Ziel dieser Untersuchung ist es, ein valides und einfaches Screeninginstrument in den Klinikalltag zu integrieren um eine objektivere, rationale Tumortherapie zu gewährleisten.
Hintergrund: Das Alter eines älteren Patienten sagt nichts über seinen Fitness bzw. Gebrechlichkeitszustand aus. Da man bei einem älteren Patienten allerdings mit eingeschränkten Organfunktionen und einer eingeschränkten Pharmakokinetik rechnen muss, muss evtl. auch die Dosis der Chemotherapie angepasst werden. Die Screeningfragebögen sollen dazu dienen. Es kommt der G8 Fragebogen sowie der übersetzte Hurria Score zum Einsatz. Bei einem auffälligen Screening werden die Patienten mit dem geriatrischen Assessment evaluiert, der momentan der von mehreren Gesellschaften empfohlene Goldstandard ist. Somit soll zusätzlich Versorgungsforschung stattfinden, also der Frage nachgegangen werden: Welche und wie viel Zusatztherapien brauchen wir, wenn wir ein geriatrisches Screening durchführen?