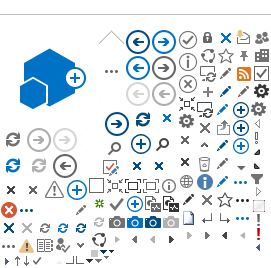PROSPEKTIVE STUDIE ZUR EPIDEMIOLOGIE UND THERAPIE THERMISCH VERLETZTER KINDER
Die Klinik für Kinderchirurgie beteiligt sich seit vielen Jahren an einer Multicenterstudie der Deutschen Gesellschaft für Verbrennungsmedizin und trägt dabei mit epidemiologischen Daten sämtlicher stationär in unserer Klinik behandelter Kinder mit thermischen Verletzungen zur bundesweiten Erfassung aller schwer-brandverletzten Kinder im „Verbrennungsregister" bei.
Die Ergebnisse werden alljährlich im Januar zur DAV-Tagung präsentiert und bilden eine Grundlage zur kontinuierlichen Verbesserung der Prophylaxe thermischer Verletzungen sowie deren Behandlungsoptimierung.
Ansprechpartnerin:
DATENBANKANALYSE DER CHIRURGISCHEN VERSORGUNG VON SELTENEN ERKRANKUNGEN DES NEUGEBORENEN ANHAND VON GKV-ROUTINEDATEN
Bei der Ösophagusatresie und Gastroschisis handelt es sich um seltene, angeborene Fehlbildungen, die einer chirurgischen Korrektur bedürfen. Hierbei können postoperative Komplikationen entstehen, welche die Lebensqualität der Kinder beeinträchtigen und somit eine lange Nachsorge notwendig machen. Diese ist wiederum mit Kosten für das Gesundheitssystem verbunden. Aufgrund fehlender Untersuchungen und Kostenanalysen zu diesem Thema, war das Ziel der vorliegenden Studie die Kosten von Patienten mit kinderchirurgischen Operationen am Beispiel der Ösophagusatresie und der Gastroschisis zu analysieren.
Untersucht wurden hierbei alle stationären Abrechnungs- und Leistungsvorgänge auf Basis von Routinedaten der Techniker Krankenkasse im Zeitraum vom Januar 2007 bis August 2012. Bisherige Ergebnisse weisen darauf hin, dass postoperative Komplikationen aus Sicht der Kostenträger eine finanzielle Belastung darstellen und Maßnahmen zur Reduzierung der Komplikationen zu erarbeiten sind.
Ansprechpartner:
Genetische
Untersuchungen von Kindern mit uro-rektalen Erkrankungen und deren Familien im
Rahmen eines multizentrischen Forschungsverbundes (CURE-Net)
Ziel des Netzwerks für kongenitale uro-rektale Malformationen (CURE-Net) ist es, neben der molekularbiologischen Grundlagenforschung, den postoperativen Behandlungserfolg und die unterschiedlichen Formen der Nachsorge durch multizentrische, klinische und psychosoziale Forschung mit Hilfe standardisierter Untersuchungsverfahren zu evaluieren. Das Netzwerk wurde 2009-2012 durch das BMBF gefördert.
Seit 2013 erfolgt eine Förderung des Registers in Heidelberg durch die DFG. CURE-Net nutzt einen multidisziplinären Ansatz, um die genetischen und umweltfaktoriellen Ursachen uro-rektaler Fehlbildungen zu identifizieren und eine bessere klinische Versorgung der Patienten und ihrer Familien zu gewährleisten. Um den Erfolg der grundlagenwissenschaftlichen und klinischen Forschungsprojekte von CURE-Net zu garantieren, sind eine umsichtige Organisation, Projektcontrolling und Evaluation der Rekrutierung, eine detaillierte Erfassung der Patientenphänotypen und die Errichtung einer zentralen DNA-Biomaterial-Bank erforderlich.
Ansprechpartner:
Genetische
Untersuchungen von Kindern mit Ösophagusatresie und deren Familien im Rahmen
eines multizentrischen Forschungs-verbundes (GREAT-Studie)
Genetische Faktoren können an der Entstehung angeborener Fehlbildungen der Speiseröhre beteiligt sein. Allerdings sind die zugrundeliegenden genetischen Ursachen trotz aller medizinischen Fortschritte bei den meisten Betroffenen noch unbekannt. Darüber hinaus sind viele Fragen zum Behandlungserfolg bei Kindern und Erwachsenen mit Fehlbildungen der Speiseröhre bis heute unbeantwortet, da die vorliegenden Erkenntnisse zumeist auf den Erfahrungen einzelner Kliniken oder einzelner Chirurgen beruhen.
Das GREAT-Konsortium (genetic risk of esophageal atresia) hat es sich daher zum Ziel gesetzt, moderne Prinzipien der wissenschaftlichen Grundlagenforschung in den Bereichen der Genetik und der Molekularbiologie zu kombinieren, um die Ursachen angeborener Fehlbildungen der Speiseröhre zu identifizieren und durch multizentrisch klinische Forschung den operativen Behandlungserfolg in einer Querschnittsstudie zu evaluieren. An diese Analysen und Untersuchungen sind die Erwartungen geknüpft, zu einem eingehenden Verständnis der Ursachen und molekularbiologischen Zusammenhänge angeborener Fehlbildungen der Speiseröhre zu gelangen sowie eine evidenzbasierte standardisierte klinische Versorgung zu schaffen.
Die erfolgreiche Umsetzung dieser Vorhaben erfolgt durch den Zusammenschluss wissenschaftlicher Institute und Zentren der medizinischen Versorgung innerhalb Deutschlands, eingebettet in ein strukturiertes und multidisziplinäres Konsortium.
Ansprechpartner: