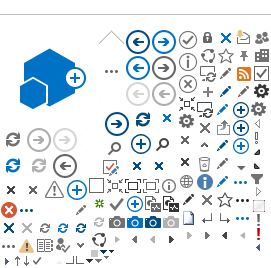Schulmedizin, alternative Heilverfahren, Komplementärmedizin - bei einer
Krebserkrankung greift so mancher Betroffene nach allem, was helfen könnte. „Die
sogenannte Schulmedizin, die wir wissenschaftliche Medizin nennen, umfasst alle
diagnostischen und therapeutische Verfahren, die aufgrund wissenschaftlicher
Nachweise von Vorteil für den Patienten sind", erklärt Prof. Lordick. „Was mit
dem Wort Alternativmedizin umschrieben wird, sind Methoden und Verfahren, die
angeblich statt der wissenschaftlichen Medizin eingesetzt werden können, obwohl
überzeugende Daten bezüglich Wirksamkeit und Unbedenklichkeit fehlen. Die
Komplementärmedizin wiederum umfasst Verfahren, die - ergänzend zur
wissenschaftlichen Medizin - das Befinden des Patienten verbessern können."
Alternative Heilverfahren statt der bewährten wissenschaftlichen Therapien
einzusetzen, hält der Direktor des Universitären Krebszentrums Leipzig für
äußerst gefährlich, weil Heilungschancen verloren gehen können. Gegen
Komplementärbehandlungen wie Yoga oder andere Entspannungsverfahren oder sogar
manche Therapien auf stofflicher Basis (Pflanzenprodukte, Mineralstoffe,
Vitamine) sei nichts einzuwenden, wenn die eigentliche Behandlung nicht
beeinträchtigt werde. Dies allerdings ist nicht immer so einfach herauszufinden,
da viele Komplementärverfahren eher aufgrund begrenzter persönlichen Erfahrungen
als auf der Basis belastbarer Erkenntnisse empfohlen werden.
„Der Markt der alternativen Methoden und Therapeutika ist sehr schillernd und
wird teils von Anbietern bedient, die vor allem Geld verdienen wollen", so Prof.
Lordick. „Ich rate meinen Patienten, mit mir zu besprechen, was sie ergänzend
anwenden wollen. Manches macht Sinn, manches nicht, sondern kostet nur Geld -
und kann total kontraproduktiv sein."
Die Psychologin Prof. Mehnert-Theuerkauf kann das Verhalten mancher Patienten
nachvollziehen: „Aus psychologischer Sicht ist es gut, wenn man etwas für sich
tut, wenn Patienten und Angehörige aktiv etwas zur Genesung beitragen möchten.
Aber wenn dadurch Gefahren entstehen, sollte man das Angebot des Arztes annehmen
und ohne Angst mit ihm besprechen, was sie vorhaben. „Wir wissen, dass manche
Patienten ganz viel zusätzlich zur wissenschaftlichen Therapie machen, es aber
nicht sagen, weil sie denken, der Arzt wird dies vielleicht nicht gutheißen. Es
ist aber wichtig auch mit Blick auf mögliche Nebenwirkungen, in einem
vertrauensvollen Verhältnis mit dem behandelnden Arzt solche Optionen offen zu
besprechen: Ein guter Arzt ist der Partner des Patienten und sollte sich die
Zeit nehmen, um diese Optionen abzuwägen und zu einer gemeinsamen Entscheidung
und Behandlungsplanung beizutragen."
Angesichts der Vielzahl von Angeboten, die als sogenannte Alternativen
gepriesen werden, ist es sehr nachvollziehbar, Dass Patienten sich aus diesem
Riesenregal bedienen. „Reden Sie mit uns", appelliert Prof. Lordick. „Wir
erkennen sehr schnell, ob ein Angebot seriös ist oder nicht. Schöne Worte und
pseudowissenschaftliche Angaben sind vom medizinischen Laien nicht leicht zu
entlarven. Ich versichere: Wir erkennen in dem Dschungel, wo Gefahren sind. Denn
gefährliche Ansätze bei den alternativen Methoden können Patienten zu
Verhaltensweisen führen, die die eigentliche Krebstherapie ad absurdum führen,
oder ihn gefährliche Substanzen einnehmen lassen."
„Auch wenn versprochen wird, dass mit positivem Denken der Krebs zu bezwingen
ist - das funktioniert leider nicht", so Prof. Mehnert-Theuerkauf. „Natürlich ist eine
positive und optimistische Grundhaltung gut. Aber auch traurige Gedanken und ein
ernstes Nachdenken sind wichtig und nicht schädlich und gehören zur Verarbeitung
der Erkrankung dazu."
Es ist nicht nur die pure Verzweiflung, die Patienten dazu treibt,
beispielsweise dubiose Pilz- oder Kräuterpräparate einzunehmen. „Ich erinnere
mich an eine Patientin, die wir aus einem wochenlangen Niederliegen ihres
Immunsystems nur mit Glück und viel Können retteten", sagt Prof. Lordick. „Das
schlecht untersuchte chinesische Pflanzenprodukt hatte eine giftige und
zerstörerische Wirkung auf ihr Knochenmark gezeigt. Sie wollte eigentlich nur
einen eigenen Beitrag zu ihrer Genesung leisten. Zudem fühlte sie sich - wie
andere Patienten auch - einem medizinischen Apparat ausgeliefert, der etwas aus
ihr herausschneidet, ihr belastende Medikamente verabreicht und Bestrahlungen
vornimmt. Außerdem bekommen Krebspatienten von Verwandten, Freunden und
Bekannten Tipps und Ratschläge, vor denen sie sich nicht retten können. Das ist
nicht immer hilfreich. Ich zitiere da gern einen meiner Lehrer: Ratschläge sind
manchmal tatsächlich Schläge. Deshalb sollte man sich auch vor manchem gut
gemeinten Ratschlag in Acht nehmen." Denn nicht immer ist gut gemeint auch
tatsächlich gut.